
Am 1. Juni 2023 hat die EU-Kommission das Vertragsverletzungsverfahren wegen unzureichender Umsetzung der EU-Nitratrichtlinie eingestellt. Damit sind drohende Strafzahlungen in Millionenhöhe abgewendet – die EU-Kommission signalisiert, dass sie hierzulande den richtigen Weg für zukunftsfähige Düngeregeln eingeschlagen sieht.

Der Weg hierhin war jedoch mehr als verschlungen mit vielen Stolperfallen und hält nach wie vor für Landwirte erhebliche Herausforderungen bereit. Nachdem im Jahr 2017 die noch aus dem Jahr 2006 geltende Düngeverordnung (DüV) endlich novelliert war – Druck aus Brüssel gab es da schon lange – wurde relativ schnell deutlich, dass diese Vorgaben der EU Kommission nicht reichen würden, deren Forderungen zu erfüllen. Endgültig klar wurde dies mit dem EuGH-Urteil vom 21. Juni 2018, als Deutschland die entsprechende Klage verloren hat. Höchstrichterlich und juristisch unangreifbar wurde damit bestätigt, dass hierzulande gegen die Verpflichtungen der EU-Nitratrichtlinie verstoßen wurde. Es folgten eine Novelle der DüV 2020 sowie eine Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Ausweisung von mit Nitrat belasteten und eutrophierten Gebieten (AVV GeA). Die Einteilung in sogenannte „Grüne“ und „Rote“ Gebiete führte zu vielen Fragen, Kritik und massiven Protesten von Seiten des Berufsstandes. In einzelnen Bundesländern waren Klagen gegen die Landesdüngeverordnungen erfolgreich. Aber auch die EU-Kommission war noch nicht zufrieden.
 Im Juni 2021 machte sie erneut deutlich, dass Nachbesserungen bei der AVV GeA erforderlich wären. Und mit dem Urteil des EuGH aus 2018 und eines laufenden Zweitverfahrens aus 2019 saß die EU-Kommission eindeutig am längeren Hebel! Daher wurde zusammen mit den Ländern ein Entwurf zur Neufassung der AVV GeA erarbeitet. Diese Neufassung ist im August 2022 in Kraft getreten. Die Bundesländer hatten bis zum 30. November 2022 Zeit, die „Roten“ Gebiete erneut und meist deutlich umfangreicher als zunächst 2020 auszuweisen. Das wiederum führte wieder zu Wechselbädern der Gefühle bei den betroffenen Landwirten und zu neuen Protesten. Dennoch gibt es nach vielen Jahren der Unsicherheit jetzt endlich Klarheit für die Betriebe zur Ausrichtung ihrer Anbau- und Düngeplanung.
Im Juni 2021 machte sie erneut deutlich, dass Nachbesserungen bei der AVV GeA erforderlich wären. Und mit dem Urteil des EuGH aus 2018 und eines laufenden Zweitverfahrens aus 2019 saß die EU-Kommission eindeutig am längeren Hebel! Daher wurde zusammen mit den Ländern ein Entwurf zur Neufassung der AVV GeA erarbeitet. Diese Neufassung ist im August 2022 in Kraft getreten. Die Bundesländer hatten bis zum 30. November 2022 Zeit, die „Roten“ Gebiete erneut und meist deutlich umfangreicher als zunächst 2020 auszuweisen. Das wiederum führte wieder zu Wechselbädern der Gefühle bei den betroffenen Landwirten und zu neuen Protesten. Dennoch gibt es nach vielen Jahren der Unsicherheit jetzt endlich Klarheit für die Betriebe zur Ausrichtung ihrer Anbau- und Düngeplanung.
Das Ziel aller Aktivitäten muss unverändert bleiben, das Verursacherprinzip zu stärken. Die notwendige robuste und vollzugstaugliche Datengrundlage ist schnellstmöglich zu schaffen insbesondere durch die Ertüchtigung und Ausweitung des Messstellennetzwerkes. Ziel ist es, ab 2028 die sogenannte Binnendifferenzierung bundeseinheitlich mit einem geostatistischen Regionalisierungsverfahren durchzuführen.
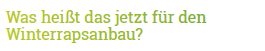
Seit 2020 wird für die Düngeplanung basierend auf dem 5-jährigen Durchschnittsertrag der N-Bedarfswert abgleitet, der noch um den Nmin-Vorrat zu Vegetationsbeginn, der Nachlieferung aus der organischen Düngung zur Vorfrucht sowie der Vorfrucht korrigiert wird. Das Jahr 2022 mit den hohen Rapserträgen – trotz N-Düngung bereits unter den Restriktionen der DüV 2020 – ist hilfreich. Raps und Körnerleguminosen als Vorfrüchte reduzieren bekanntlich den N-Düngebedarf um 10 kg N/ha gegenüber einer Getreidevorfrucht – das bleibt auch weiterhin so. Damit ist die Höhe der N-Gesamtmenge festgelegt, die nur um max. 10 % infolge nachträglich eintretender Umstände überschritten werden darf. Die UFOP empfiehlt darüber hinaus, den Düngebedarf nach der Frischmassemethode zu ermitteln, um den bereits zu Vegetationsende in der Blattmasse des Rapses gebundenen auf die Frühjahrsgabe anrechenbaren Stickstoff zu berücksichtigen.

In den „Roten“ Gebieten gilt die Vorgabe, dass im Mittel aller betroffenen Flächen 20 % unter dem N-Bedarf zu düngen ist. Der Landwirt kann dabei entscheiden, bei welcher Kulturart die Einschränkung zu erfolgen hat.
Eine N-Düngung im Herbst als ertragssichernde Maßnahme ist bis zum 1. Oktober nach der DüV mit max. 60 kg N/ha (30 kg Ammonium-N/ha) bei Aussaat bis zum 15. September zwar erlaubt, aber meistens wenig sinnvoll, da die Ertragswirkung deutlich geringer ist als die der Frühjahrsdüngung. Zudem muss die Herbst-NMenge auf den Düngebedarf voll angerechnet werden und reduziert somit die im Frühjahr zur Verfügung stehende Menge entsprechend.
Auch wenn es banal klingt, soll darauf hingewiesen werden, dass eine im Hinblick auf Termin und Bedingungen bestmögliche Aussaat Voraussetzung für eine gute Herbstentwicklung und Ertragsbildung im Frühjahr ist. Situationen, die in alten Zeiten mit „Reparatur-Stickstoff“ noch in den Griff zu bekommen waren, sind auf alle Fälle zu vermeiden.

Lesen Sie jetzt die weiteren Informationen zur Winterrapsaussaat 2023:


 Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen E.V.
Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen E.V.
